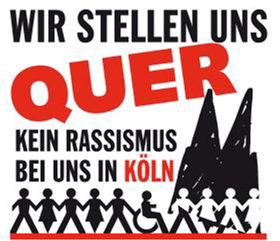Im aktuellen Newsletter vom Dezember ist ein Nachruf von Peter Liebermann auf Christiane Hoss erschienen den wir jetzt hier zum Eingedenken veröffentlichen:
Christiane Hoss starb am 9. November 2025 mit 83 Jahren. Was wäre der Verein EL-DE-Haus ohne sie geworden? Es ist schwierig sich das vorzustellen, bei den vielen Ideen und Aktivitäten, die sie einbrachte, und nicht zu vergessen, als Mitglied des Gründungsvorstandes und Kassiererin trug sie maßgeblich zur Gestaltung der Strukturen bei, aus denen der Verein sich weiterentwickeln konnte. Christiane drängte sich nie in den Vordergrund, politische Sonntagsreden waren ihr zuwider, sie wollte etwas bewirken. Das hat sie sicherlich erreicht, ohne dass ihr Engagement öffentlich ausreichend gewürdigt wurde.
Ich lernte Christiane 1983 kennen. Sie war damals bereits 3 Jahre Geschäftsführerin der Kölnischen Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, ich Medizinstudent und in der Fachschaft Medizin aktiv. Sowohl die Fachschaft Medizin als auch die Kölnische Gesellschaft waren unabhängig voneinander interessiert, die in Tübingen entwickelte Ausstellung „Volk & Gesundheit. Heilen und Vernichten im Nationalsozialismus“ in Köln zu zeigen. So kamen wir zusammen und es entstand die Idee, die Ausstellung mit Materialien aus Köln zu ergänzen. Christiane hatte den Schwerpunkt jüdisches Gesundheitswesen und die Krankenmorde. In ihrer akribischen Art durchforstete sie in der Germania Judaica alle relevanten Zeitschriften aus der Zeit und sichtete anderenorts Archivalien. Sie erfasste Vorgänge sehr schnell und konnte dadurch Kontexte neu erschließen. Ein Beispiel dafür ist das Sachverständigengutachten von Dr. Lebenstein aus dem Düsseldorfer Euthanasie-Prozess von 1948. Dort war eine Vielzahl der Transporte aus den psychiatrischen Kliniken im Rheinland in die Vernichtungsanstalten gelistet, allerdings nach Orten gegliedert. Christiane ordnete die 261 Transporte chronologisch mit der Schreibmaschine. Daraus ließ sich erstmals die Systematik des Vernichtungsprozesses erfassen. Ein Ergebnis der Ausstellung war die spätere Umbenennung der Haedenkampstraße in Herbert-Lewin-Straße.
Zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Ausstellung 1985 entwickelte sich nach der Rede des Bundespräsidenten von Weizsäcker die Überlegung, endlich für die Umsetzung des Ratsbeschlusses von 1979 zur Einrichtung eines NS-Dokumentationszentrums zu sorgen. Christiane war als Vertreterin der Kölnischen Gesellschaft in der Initiative aktiv. Hierzu organisierten wir eine Vielzahl von Veranstaltungen, die dazu dienten, auf die Lücken in Bezug auf die Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Köln, insbesondere die “vergessenen“ Opfergruppen aufmerksam zu machen. Unterschriftensammlungen und Mahnwachen vor dem EL-DE-Haus wurden von ihr organisiert und sie nutzte ihre Kontakte in die Politik und Stadtgesellschaft, um die Idee voranzutreiben.
Nachdem die Initiative ihr Ziel erreicht hatte, wurde der Verein-EL-DE-Haus gegründet. Sie übernahm die Position der Kassiererin und schuf die Grundlage für eine solide Struktur. Daneben war Christiane aktiv beteiligt, die erste Broschüre des Vereins zum Thema „Arisierung“ zu gestalten. Als Teil einer Arbeitsgruppe hatte sie aus Zeitschriften Materialien zusammengestellt, die den Prozess der Arisierung ihn Köln dokumentierten. Gleichzeitig war es ihr immer ein Anliegen, den bislang von Entschädigung ausgeschlossenen Opfergruppen Anerkennung zu verschaffen.
Christiane setzte sich mit dafür ein, dass die Informations- und Beratungsstelle für NS-Verfolgte zunächst organisatorisch beim Verein angesiedelt war. Dies stellte für sie einen zusätzlichen Arbeitsaufwand dar, da der Verein nun Beschäftigte hatte.
Sie sorgte dafür, dass die Beratungsstelle Räume in der Kämmergasse oberhalb der Kölnischen Gesellschaft bekam und unterstützte die Beratungsstelle intensiv in ihrer herzlichen Art.
1990 wechselte Christiane als Geschäftsführerin zum Aktiven Museum Faschismus und Widerstand in Berlin, das sich dafür einsetzte, auf dem ehemaligen Gestapogelände in der Prinz-Albrecht-Straße ein Museum einzurichten, heute die Topographie des Terrors. Die Entwicklung bis dahin hat sie kritisch begleitet. In Berlin entstanden auch mehrere bahnbrechende Ausstellungsprojekte, wie „Haymatloz. Exil in der Türkei 1933-1945“ oder „ 1945: Jetzt wohin? Exil und Rückkehr“. Letztere diente als Idee für unsere Ausstellung „Unter Vorbehalt Rückkehr aus der Emigration nach 1945“.
Aufgrund ihres Engagements in Berlins wurde zunehmend deutlich, dass eine weitere Vorstandstätigkeit im Verein EL-DE-Haus sich nicht mehr anbot und so schied sie 1992 aus. Christiane blieb aber weiterhin als Ansprechpartnerin für inhaltliche Fragestellungen verfügbar. Nach ihrer Berentung und der Rückkehr nach Köln arbeitete sie für das NS-Dokumentationszentrum 20.000 Akten der Oberfinanzdirektion Köln auf. Durch diese Arbeit konnten eine Vielzahl bis dahin unbekannter Verfolgungsschicksale rekonstruiert werden, so dass diese Menschen gewürdigt werden konnten.
Christiane war eine kluge, belesene und neugierige Frau. Themen, die sie interessierte, erschloss sie sich in der Tiefe, sei es zur Kölner oder Berliner Stadtgeschichte oder englischer Literatur. Ihr politisches Engagement ist nur eine ihrer vielen Facetten. Sie war für ihre Kinder da, pflegte ihre Freundschaften, kochte gerne für alle und sorgte sich um einen. In den letzten Jahren wurde es für sie gesundheitlich herausfordernder. Christiane blieb trotzdem weiterhin wach und an gesellschaftlichen Entwicklungen interessiert. Mit großer Sorge sah sie den anwachsenden Antisemitismus und das Erstarken der neuen Rechten.
Christiane Hoss wird uns mit der Präzision ihres Denkens, ihrem Ideenreichtum, ihrem Engagement und besonders ihrer Menschlichkeit fehlen.
Peter Liebermann